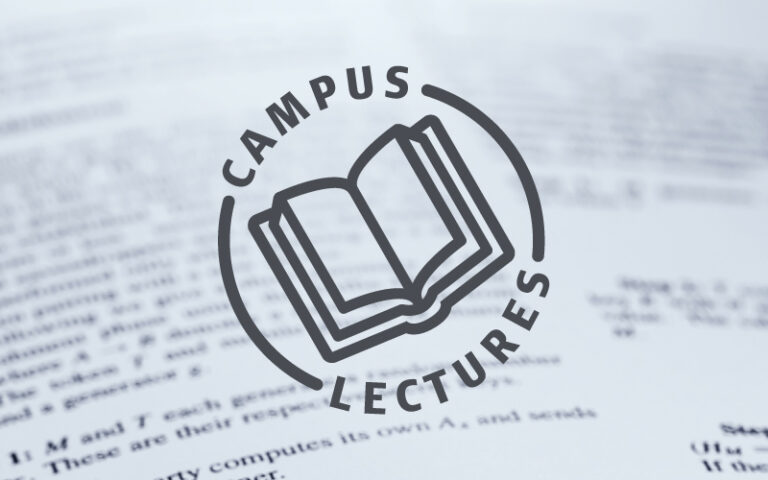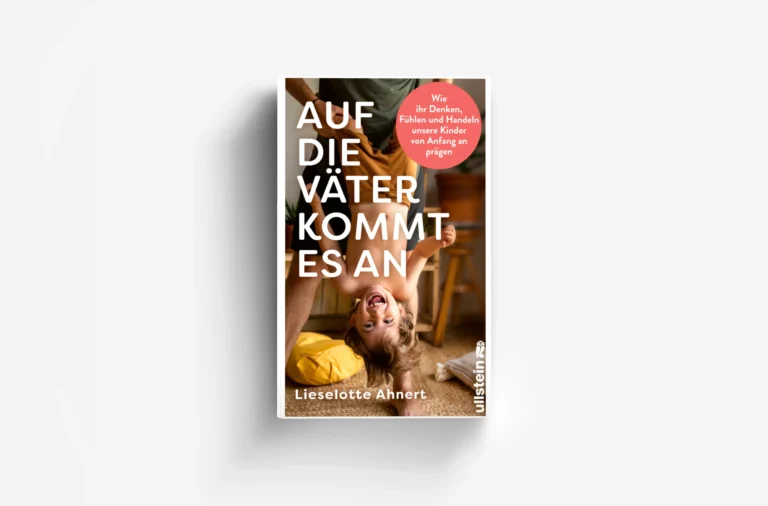Zwischen Labor und Laufstall – Väter in der Wissenschaft unter Druck
Akademisch ausgebildete Väter erleben den Balanceakt zwischen Karriere und Familie oft besonders intensiv: Sie werden später Väter, übernehmen immer mehr Verantwortung im Familienalltag – und stoßen dabei an strukturelle, gesellschaftliche und persönliche Grenzen. Die aktuelle Väterforschung zeigt, wie sich neue Vaterleitbilder entwickeln, wo die Herausforderungen liegen – und welche Rolle Partnerinnen, Arbeitgeber und die Politik dabei spielen.
🔍 Was bedeutet erfolgreiche Elternschaft heute wirklich?
🤝 Welche Kompetenzen brauchen Väter – und wie werden sie unterstützt (oder ausgebremst)?
📚 Und warum kann gerade das „schwierige Gespräch“ mit dem Vater entscheidend für die Sprachentwicklung eines Kindes sein?
Ein tiefgehender wissenschaftlicher Beitrag von Lieselotte Ahnert beleuchtet all das – mit besonderem Fokus auf Väter im Wissenschaftsbetrieb.
Zum Beitrag: https://www.forschung-und-lehre.de/karriere/aktuelle-vaeterforschung-und-besonderheiten-bei-akademikern-7156